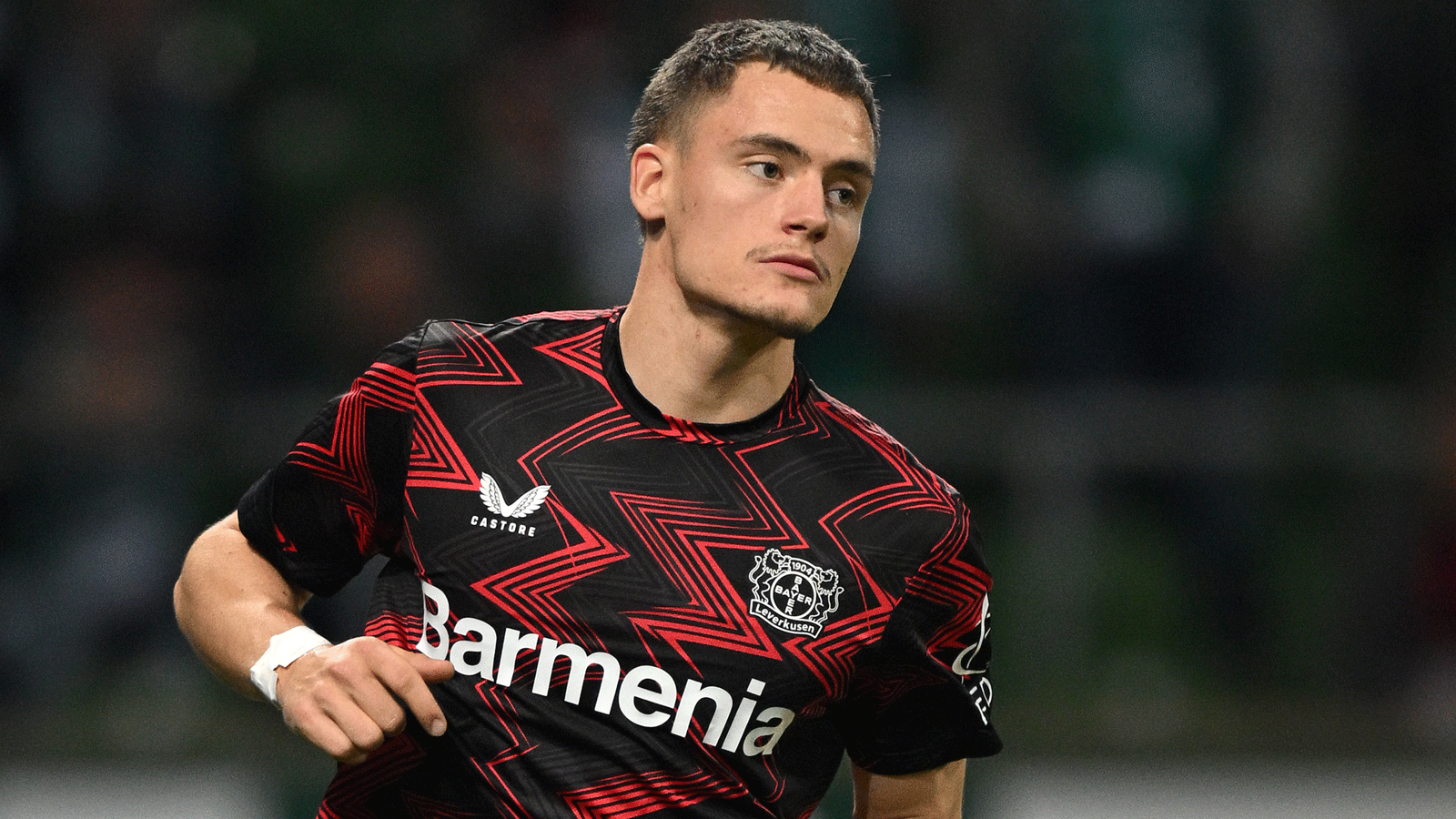Nach der Silbermedaille ging der Wahnsinn ja aber erst richtig los. Wie haben Sie den folgenden Medienhype überstanden?
Busemann: Ich habe darüber erstmal gar nicht nachgedacht. Wenn die sagen, ich soll das machen, dann habe ich das eben gemacht. Es dauerte bis Weihnachten, dass ich mal ein bisschen Ruhe hatte und nachdenken konnte, davor war ich komplett im Tunnel. Ein guter Freund sagte mir damals: Das ist ja alles schön und gut, dass du da tollen Sport gemacht hast in Atlanta, aber wenn du dich jetzt gar nicht mehr meldest, dann finde ich das scheiße. Wenn du keine Zeit hast, dann sag mir das, dann kann ich mich darauf einstellen, aber tue nicht so, als ob wir nicht da wären. Es war gar nicht böse gemeint und es tat mir auch leid, ich hatte das einfach komplett vergessen. Wenn mir die Leute sagten, dass ich mich schonen sollte, habe ich immer gedacht: Ich sage doch schon 80 Prozent aller Termine ab, das ist doch nicht zu viel, was ich mache. Ich habe ja auch noch die Ausbildung bei der Sparkasse Dortmund absolviert und hatte da nur eine Vereinbarung. Wenn ich Termine habe, dann kann ich auch mal in der Arbeitszeit gehen. Aber ich war dann auch am nächsten Morgen wieder da und habe um 8 Uhr die Geschäftsstelle aufgeschlossen.
Irgendwie lag Ihnen ja auch die Rolle als Interview-Partner und Talkshow-Gast, Sie waren von Anfang an ein Segen für alle Journalisten. Endlich war mal einer locker und hat gelabert.
Busemann: Ich schätze mich an sich als sehr schüchtern ein, aber der Sport hat mir geholfen zu reden. Wenn ich an meine Interviews in Atlanta denke, da stand ich mit Schnappatmung und hochroter Birne vor den Journalisten und habe drauflos geplappert. Atlanta hat mir sehr in die Karten gespielt. Ich musste nach dem Wahnsinn Druck ablassen und die Ersten, die mir über den Weg gelaufen sind, waren die Journalisten - also habe ich sie vollgequatscht. Die waren wiederum froh, dass einer was erzählt hat. So sind wir sehr gut miteinander ausgekommen. Ich habe es mit der Zeit auch lieben gelernt, Interviews zu geben. Es ist ja eigentlich auch eine ganz einfache Geschichte. Ich referiere ja nicht über die Apokalypse der Blutsynthese. Ich rede über das, was mich selbst betrifft und mein Gegenüber hat Interesse daran. Eigentlich ist es sogar eine sehr dankbare Aufgabe.
Ihr Vater Franz-Josef war während der ganzen Zeit immer an Ihrer Seite und wurde so selbst zur Kultfigur. Was hat Ihre Vater-Sohn-Coach-Sportler-Beziehung so besonders gemacht?
Busemann: Mein Vater wollte sich nie über mich verwirklichen. Er hatte Spaß daran, mich im Sport zu unterstützen und stand mir als Ideengeber und Ratgeber zur Seite. Er hat mich niemals zum Training gedrängt, er musste mich bremsen. Dienstags haben wir immer die schlimmsten Programme gemacht. 600 Meter, 500 Meter, 400 Meter, bis zum Umfallen. Ich hatte Angst davor, aber fand es auch geil. (lacht) Wenn ich dann nach den 500 Metern am Boden lag und nicht mehr konnte, wollte ich immer noch weitermachen, aber mein Vater sagte dann auch mal: Du siehst nicht so aus, als ob du noch kannst. Dann hat er auch mal Läufe gestrichen. Ich wollte unbedingt und er gab die Richtung vor - wir waren ein perfektes Gespann.
Wollten Sie nie ausbrechen und das genießen, was andere in dem Alter so treiben?
Busemann: Ich habe Sport geliebt. Sport war das absolut wichtigste in meinem Leben, ich hatte überhaupt kein Bedürfnis nach anderen Dingen. Ich hatte nie das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Mir hat es nichts bedeutet, Samstagabend auf Partys zu gehen. Ich wurde mal gefragt, wann ich denn das letzte Mal in der Disco gewesen wäre? Wie das letzte Mal? Ich war erst einmal. Oder was mein letztes Konzert gewesen wäre? Ich war noch nie auf einem Konzert, was denn bitte für ein Konzert?! (lacht) Unser Familienthema war Sport. Im Umkehrschluss hat es natürlich dazu geführt, dass ich lange keine Ahnung hatte, was es heißt, Urlaub zu genießen. Meine Frau musste mir erstmal beibringen, wie man Urlaub macht, bis heute habe ich das immer noch nicht so richtig gelernt. Bis zu meinem 28. Lebensjahr bin ich nur in Trainingslager gefahren, etwas anderes kannte ich gar nicht.

Die Silbermedaille von Atlanta blieb nicht Ihr einziger großer Erfolg, ein Jahr später folgte Bronze bei der WM in Athen. War diese Medaille vielleicht noch unglaublicher?
Busemann: Ja, diese Bronzemedaille war eigentlich noch höher einzuschätzen als Silber in Atlanta. Ich hatte im Vorfeld von Athen riesige Probleme mit der Hüfte und wusste nicht mal, wie ich aus dem Bett steigen soll. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich drauf habe. Der Zehnkampf wurde zu einer totalen Kraftnummer. Aber bei dieser WM habe ich den besten Weitsprung meines Lebens gemacht. Vorher habe ich mir beim Weitsprung fast immer den Fuß gebrochen, aber in Athen ging das mit einer Leichtigkeit, das war unglaublich. Weitsprung habe ich ja eh nie trainiert, sondern nur im Wettkampf gemacht. Das hört sich großkotzig an, aber ich hatte einfach immer Angst, mich zu verletzen. Und Weitsprung war die Disziplin, die ich schon immer konnte. Ich bin mit 10 Jahren 5,15 Meter gesprungen, Weitsprung hatte ich drauf. Obwohl ich vor Athen so zweifelte, hatte ich plötzlich auch wieder dieses Wettkampfgefühl. Sobald es zählte, konnte ich den Schalter umlegen und wusste selbst nicht, wo das jetzt herkam. Bei den 400 Metern dachte mein Vater, dass ich nicht unter 50 Sekunden laufen kann. Ich lief 48,32, die Bestleistung steht heute noch. Aber ich bin dann auch eine Stunde da gelegen. (lacht)
Sie hatten Olympia-Silber und WM-Bronze auf dem Konto, es fehlte Gold. In den Jahren danach machten Ihnen aber zahlreiche Verletzungen einen Strich durch die Rechnung. Was war in dieser Zeit das frustrierendste?
Busemann: Man muss es insofern etwas relativieren, als dass ich ja schon vorher immer verletzt gewesen bin. Als ich 13 oder 14 Jahre alt war, wurde mir schon gesagt, dass ich es mit meinem Körper lieber bleiben lassen soll. Wer sich meine Beine und meinen Oberkörper anguckte, sagte: Das kann nichts werden. Zum Glück habe ich mich nicht beeinflussen lassen. Am schlimmsten war vor Sydney die Diagnose Ermüdungsbruch. Da habe ich wirklich ins Telefon geschrien: Warum ich? Warum immer ich? Zu diesem Zeitpunkt waren es drei Jahre hintereinander mit Verletzungen. Ich konnte nicht verstehen, wer es da so böse mit mir meint.
War es besonders schlimm, weil Sie das große Ziel 9000 Punkte im Kopf hatten?
Busemann: Die 9000 Punkte waren der Grund, warum ich Verletzungen nie richtig ausheilen lassen konnte. Nach dem Motto: Mist, nächste Woche kommt der Dvorak und macht die 9000 und ich sitze hier auf der Couch und mache nix! Als er dann 1999 die 9000 auf der Kelle hatte, dachte ich schon, dass jetzt mein Lebensziel weg ist. Bis der Bundestrainer anrief und mir sagte, dass Dvorak 6 Punkte fehlen. Meine Reaktion war nur: Jaaaaaaaaaa! (lacht) Als Sebrle 2001 die Marke dann knackte, war ich eigentlich schon gar nicht mehr in der Lage, die 9000 zu machen. Trotzdem hat es mich im ersten Moment tief getroffen. Für mich hatte es immer zwei Dinge gegeben, die unumstößlich waren. Ich werde eines Tages Olympiasieger oder Weltmeister und ich breche als Erster die 9000 oder stelle einen Weltrekord auf. Diese Ziele haben mich jeden Tag gepusht, so beschissen es mir auch ging. Ich war getrieben. Irgendwann kam dann die Zeit, als ich einsehen musste, dass ich diese Ziele nicht mehr erreichen kann. Das war brutal schwer für mich. Ich hatte es mir vorgenommen, da konnte ich doch jetzt nicht sagen, dass es nicht geht. Das war eine harte Zeit und hochgradig ätzend für mein Umfeld.